Schulabsentismus / Schulschwänzen
Wenn Angst zum Fernbleiben vom Unterricht führt
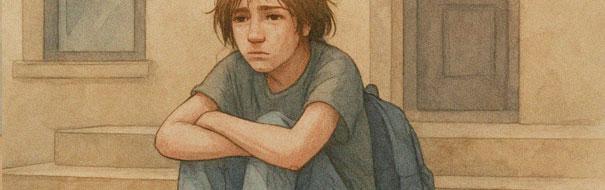
Das gelegentliche Fernbleiben von der Schule ist weit verbreitet und in vielen Fällen kein Grund zur Sorge. Trotzdem sollten die Ursachen genauer betrachtet werden. Liegen etwa belastende Umstände dem Absentismus zugrunde, sollte gehandelt werden.
Angst vor Prüfungen, vor Mitschülern oder vor der Schule selbst kann so belastend werden, dass die Betroffenen dem Unterricht fernbleiben. Dieses Verhalten wird als Schulvermeidung oder Schulabsentismus bezeichnet. Häufig beginnt es mit einzelnen versäumten Tagen, kann aber rasch zu einem dauerhaften Verhalten werden. Je länger der Schule ferngeblieben wird, desto schwerer fällt die Rückkehr.
Was ist Schulabsentismus?
Wenn Angst stärker ist als Pflicht
Schulabsentismus beschreibt das wiederholte oder längere Fernbleiben vom Unterricht ohne ausreichende Entschuldigung. Die Ursachen können vielfältig sein und erfordern jeweils unterschiedliche Maßnahmen. Grundsätzlich gilt: Wenn das Schulschwänzen zur Gewohnheit wird, lange anhält oder hartnäckig trotz mehrmaliger Ermahnung aufrechterhalten wird, sollte man die Gründe herausfinden.
Dabei ist abzuwägen, ob harmlose Gründe wie Faulheit oder rebellisches Verhalten vorliegen oder ob tiefsitzende Ängste und schlechte Erfahrungen die Ursachen sind. Natürlich wäre es sinnvoll, schlicht nachzufragen, warum dem Unterricht ferngeblieben wird. Das hängt jedoch ganz von der individuellen Gesprächsbasis und der Auskunftsbereitschaft des Betroffenen ab und kann manchmal schwierig sein.
Bei angstbedingter Vermeidung erleben Kinder oft schon am Morgen starke Bauchschmerzen, Übelkeit oder Panik. Das kann zu Auseinandersetzungen in der Familie führen und eine Belastung für alle Beteiligten sein. Allerdings gibt das Drama am Morgen den Erziehungsberechtigten auch einen Eindruck vom Ausmaß der Angst. Sie können schneller und direkter reagieren und haben einen guten Überblick über Häufigkeit und Dauer des Absentismus.
Nicht jedes Fehlen ist Schwänzen. Eltern und Lehrkräfte sollten genau hinschauen, ob Angst oder andere psychische Belastungen hinter dem Fernbleiben stehen.
Ursachen und Auslöser
Die Gründe für Schulvermeidung sind vielfältig. Prüfungsangst, soziale Ängste oder Mobbing gehören zu den häufigsten Ursachen. Auch der Druck, gute Leistungen zu erbringen, kann dazu führen, dass Kinder sich dem Unterricht nicht mehr gewachsen fühlen.
Manche Schüler entwickeln Ängste vor ganz bestimmten Situationen: Präsentationen, Tests oder sogar Pausen oder dem Schulweg. Andere empfinden die Schule insgesamt als bedrohlich.
Finden Sie heraus, was Angst auslöst: Ist es ein Fach, ein Lehrer oder die Mitschüler? Nur so lassen sich passende Lösungen entwickeln.
Auch familiäre Probleme können eine Rolle spielen. Streit, Trennungen oder schwierige Phasen können Ängste verstärken und den Schulbesuch erschweren. Häufig wirken mehrere Faktoren zusammen. Manche dieser Gründe vergehen nach einer Zeit, andere bleiben verborgen oder sind nicht zu ändern. Versuchen Sie zumindest, die wichtigsten Ursachen herauszufinden – manchmal ist es gar nicht notwendig, alle Probleme zu lösen.
Folgen für die Betroffenen
Wenn Schüler längere Zeit nicht am Unterricht teilnehmen, kann das den Schulerfolg gefährden. Mit zunehmender Dauer wird es schwieriger, den Anschluss wiederzufinden, und die Angst vor dem Wiedereinstieg steigt. Auch das soziale Umfeld der Betroffenen leidet, etwa wenn Freundschaften vernachlässigt werden oder man nicht mehr fester Bestandteil der Klassengemeinschaft ist. Dieses Gefühl der Isolation kann wiederum die Angst verstärken und zu weiterem Schulschwänzen führen.
Je länger ein Schüler der Schule fernbleibt, desto schwerer ist die Rückkehr.
Neben der psychischen Belastung können die Auswirkungen auf die berufliche Zukunft bedrohlich werden: Fehlende Abschlüsse erschweren den Zugang zu höherer Bildung und verringern berufliche Chancen. Zukunftsängste können dadurch verstärkt und das Selbstbewusstsein vermindert werden.
Vergessen Sie jedoch nicht, dass die möglichen Auswirkungen nicht unbedingt die tatsächlichen Folgen sein müssen. Schulabbruch, Zukunftsängste und Isolation sind zwar möglich, aber nicht jedes Fernbleiben von der Schule führt direkt ins Verderben. Versuchen Sie, die Sache mit der nötigen Distanz zu betrachten: Welche Probleme gibt es, wo kann geholfen werden und wie können Folgen gemildert werden.
Wie Eltern und Lehrer helfen können
Versuchen Sie, die Angst ernst zu nehmen und nicht einfach mit Strafen oder Vorwürfen zu reagieren. Verständnis und Vertrauen sind nicht nur die Basis für eine Lösung, sondern auch notwendig, um die Ursachen herauszufinden.
Hilfreich ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. Vergessen Sie jedoch nicht, den Betroffenen einzubeziehen: Arbeiten Sie gemeinsam an den Problemen, ohne Maßnahmen von oben herab zu diktieren. Regelmäßige Gespräche und klare Absprachen schaffen Verbindlichkeit und zeigen dem Kind, dass es nicht allein ist.
Erstellen Sie gemeinsam einen Plan, wie die Rückkehr gelingen kann – Schritt für Schritt, beginnend mit einzelnen Stunden oder Tagen.
Lehrkräfte können zudem individuelle Erleichterungen anbieten, etwa das Aufschieben von Prüfungen oder zusätzliche Prüfungstermine. Das verschafft Zeit, versäumte Inhalte nachzuholen oder verpasste Prüfungen doch noch abzulegen. Auch das soziale Umfeld der Klasse ist wichtig. Vertrauenswürdige Freunde können informiert werden und Teil der Lösung sein. Beachten Sie aber, dass das Klassengefüge auch Teil des Problems sein kann, etwa wenn es zu Mobbing kommt.
Tipps für den Neuanfang
Die Rückkehr in die Schule sollte vorbereitet sein. Einfach nur wieder regelmäßig die Schule zu besuchen, reicht häufig nicht aus. Der Einstieg kann überfordern und zu Rückschlägen führen. Bleibt etwa der Schulerfolg gleich zu Beginn aus, kann dies frustrierend sein und es kommt zu neuem Schulschwänzen. "Ich habe es probiert, und es funktioniert nicht. Was soll ich an der Schule, wenn ich ohnehin keinen Erfolg habe?" Solche und ähnliche Gedanken entstehen erst gar nicht, wenn die ersten Tests und Prüfungen nach dem Wiedereinstieg erfolgreich sind. Gemeinsames Lernen und Vorbereiten steigert die Chance auf eine gelungene Rückkehr deutlich.
Versuchen Sie auch, klare Ziele zu formulieren. Hier gilt: Besser kleine Teilziele, die rasch erreicht werden können, als große Ziele in ferner Zukunft. Solche kleinen Erfolgserlebnisse sind wichtig. Positive Rückmeldungen oder eine bestandene Prüfung können Signale sein, sich auf dem richtigen Weg zu befinden. Sie verdienen daher auch Anerkennung und Lob.
Langfristig ist entscheidend, dass die Betroffenen lernen und spüren: Sie können ihre Angst überwinden und erfolgreich am Schulleben teilnehmen. Sie sind ein wichtiger Teil des Klassenverbandes und können im Schulalltag auch schöne Dinge erkennen.
Bauen Sie Routinen auf: ein fester Schlafrhythmus, vorbereitete Schultaschen und feste Zeiten helfen, Sicherheit zu gewinnen.
- Siebke Melfsen, Susanne Walitza (Beltz, 2013): Soziale Ängste und Schulangst Entwicklungsrisiken erkennen und behandeln
- Frances Hoferichter, Diana Raufelder (Kohlhammer Verlag, 2017): Prüfungsangst und Stress Ursachen, Wirkung Und Hilfe
- Helga Knigge-Illner (Campus Verlag, 2017): Prüfungsangst besiegen. Wie Sie Herausforderungen souverän meistern
- Werner Metzig, Martin Schuster (Springer, 2006): Prüfungsangst und Lampenfieber
- Das könnte Sie auch interessieren:
- Medikamente bei Prüfungsangst
- Blackouts bei Prüfungen verhindern
