Alkoholiker erkennen
Verhalten und Aussehen von Alkoholikern

Ein Freund, Ihr Kind oder Ihr Partner trinkt regelmäßig? Sind Sie besorgt, es könnte zu viel sein? Womöglich machen Sie sich auch Gedanken über Ihr eigenes Trinkverhalten? Das ist gut, denn eine Alkoholabhängigkeit entwickelt sich langsam und unbemerkt. Dabei wäre es wichtig, schon die ersten Anzeichen richtig zu deuten und rechtzeitig zu helfen.
Das Wichtigste in Kürze
- Alkoholiker erkennt man an typischen Verhaltensweisen und körperlichen Anzeichen.
- Typische Merkmale sind eine knollige Nase und Gesichtsveränderungen. Allerdings sind diese kein Beweis für eine Alkoholsucht – Vorsicht bei vorschnellen Diagnosen!
- Das Verhalten eines Alkoholikers hängt auch von der Schwere der Erkrankung ab.
- Wichtig ist frühes Erkennen der Abhängigkeit. So kann rechtzeitig geholfen werden und ein Abgleiten in die Sucht vermieden werden.
- Die Symptome des Alkoholismus betreffen Aussehen, Verhalten, körperliche Schäden und Psyche.
Das Trinken von Alkohol ist für viele normal. Gegen ein Glas Wein oder Bier lässt sich wenig einwenden. Doch auch hier gilt: Die Menge macht das Gift. Während gelegentlicher Alkoholkonsum weitgehend unbedenklich ist, wirken größere Alkoholmengen gesundheitsschädlich.
Es gilt also nicht nur eine Alkoholabhängigkeit rechtzeitig zu erkennen, sondern auch gesundheitsschädliches von risikolosem Trinkverhalten zu unterscheiden.
Alkoholiker erkennen: Erste Anzeichen und typische Warnsignale im Alltag
Häufig machen sich Freunde und Angehörige von Alkoholkranken Vorwürfe, die Erkrankung nicht früher erkannt zu haben und rechtzeitig geholfen zu haben. Dabei ist es gar nicht so einfach, die ersten Anzeichen richtig zu deuten. Zunächst scheint das Trinkverhalten weitgehend „normal“ – schließlich trinkt ja fast jeder einmal zu viel. Die Betroffenen spielen ihren Alkoholkonsum herunter und betonen, kein Problem zu haben.
Hier ist vor allem eine empathische und wertschätzende Vorgangsweise gefragt. Fragen und Gespräche zum Thema Alkohol sollten in entspannter Atmosphäre und ohne Druck stattfinden. Vermeiden Sie Vorwürfe und verurteilen Sie nicht. Sprechen Sie sachlich und ruhig Ihre Beobachtungen und Sorgen an, Gefühlsausbrüche und Aufregung helfen nicht.
Achten Sie auf eine gute Gesprächsbasis.
Womöglich ist der Betroffene noch nicht bereit, sich seine Abhängigkeit einzugestehen. Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen. Auch wenn das erste Gespräch vielleicht nicht so verlaufen ist, wie Sie erhofft haben: Bleiben Sie im Gespräch. Achten Sie auf eine gute Gesprächsbasis. Anstatt eine Antwort herauspressen zu wollen sollten Sie auf eine vertrauensvolle und offene Kommunikation bauen. Nicht alle Fragen werden gleich beim ersten Gespräch geklärt werden können, lassen Sie sich also Zeit.
Doch was sind nun konkrete Hinweise? Welche Verhaltensweisen sollten Sie beachten und womöglich ansprechen?
- Kontrollverlust
Der Betroffene kann seinen Alkoholkonsum kaum noch steuern. Obwohl man eigentlich aufhören sollte, wird weitergetrunken. Dies geschieht auch gegen die eigene Vernunft, etwa wenn man sich dann betrunken ans Steuer setzt. - Gewohnheit
Es wird aus reiner Gewohnheit, ohne speziellen Anlass getrunken – z.B. alleine daheim. - Psychische Abhängigkeit
Das Trinken wird zu einer Notwendigkeit. Man will und kann nicht mehr auf Alkohol verzichten. Einige Wochen ohne Trinken auszukommen ist nicht mehr möglich. - Dosissteigerung
Die Menge des konsumierten Alkohols steigert sich stetig. Dies kann sich auch über einige Jahre hinziehen – man wird trinkfest, benötigt immer mehr um dieselbe Wirkung zu erzielen. - Entzugserscheinungen
Stellen sich bei fortgeschrittener Alkoholsucht ein. Beispiele wären etwa Zittern, Übelkeit oder starkes Schwitzen. Eine vollständige Liste der Entzugserscheinungen finden Sie hier.
Typisches Verhalten bei Alkoholikern: Verhaltensmuster und psychische Veränderungen
Um das Trinkverhalten eines Angehörigen besser einzuschätzen, können Sie folgenden Fragebogen verwenden:
Auffälligkeiten | Ja / Nein |
|---|---|
hat häufig eine „Alkoholfahne“ | |
Zittern (vor allem Hände) | |
häufige Gedächtnislücken | |
unruhiger Schlaf | |
Brechreiz am Morgen | |
Alkoholkonsum am Vormittag | |
versteckt Alkohol, trinkt wenn unbeobachtet | |
häufighes trinken „zur Entspannung“ | |
fährt angetrunken Auto | |
Stürze, versehentliche Verletzungen | |
häufiges Fernbleiben von der Arbeit | |
reagiert gereizt beim Thema „Alkohol“ | |
veränderter Freundeskreis, häufiges feiern | |
Punkte: | 0 |
Auswertung
Die Interpretation des Testergebnisses kann relativ frei erfolgen: Je mehr „Ja“ angekreuzt sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit für einen Alkoholmissbrauch. Wie Sie bestimmt bemerkt haben ist also keine definitive Aussage über individuelle Risiken möglich. Wer 2 oder 3 mal mit „Ja“ geantwortet hat, mag womöglich kein Alkoholproblem haben. Wenn Sie aber eine ganze Reihe der Verhaltensweisen beobachtet haben, wird es sinnvoll sein, das Thema ruhig und ohne Vorwürfe anzusprechen.
Körperliche Anzeichen von Alkoholismus: Vom Zittern bis zur Alkoholfahne
Es ist gar nicht so leicht, Hinweise für Alkoholismus zu erkennen. Einzelne Veränderungen können auch weitgehend normal sein – erst das gehäufte Auftreten kann ein Anzeichen für eine Alkoholabhängigkeit sein. Es muss betont werden, dass es sich auch nur dann um Hinweise handelt, ein „Beweis“ ist nicht möglich.
Gerade wenn man persönlich betroffen ist, kann die eigene Wahrnehmung verzerrt sein. Bemühen Sie sich um Objektivität und vermeiden Sie, Ihre Beobachtungen als „Nachweise“ einer Alkoholsucht zu präsentieren. Die Früherkennung dient nicht der „Aufdeckung“ oder „Bloßstellung“, sondern soll eine frühe, adäquate Hilfe ermöglichen.
- Mundgeruch („Fahne“, lat. „Foetor Alcoholicus“). Häufig wird versucht, die Fahne durch Kaugummis zu kaschieren.
- Übelkeit oder Erbrechen am Morgen
- Aufgedunsenes Gesicht, Gesichtsröte, erweiterte Äderchen an Wangen und Nasenflügeln
- Erhöhte Neigung zu Schwitzen
- Schlafstörungen
- Herzklopfen und Bluthochdruck
- Appetitlosigkeit
- Vergesslichkeit
- Depressionen
- Angst
- Gewichtsverlust und Unterernährung
- Gealtertes Aussehen
- Sexuelle Probleme und Potenzstörungen
- Bierbauch (im Kontrast zu eher dünnen Beinen)
- Hautveränderungen, z. B. Leberhautzeichen (Spider naevi)
- Zittern
Typisches Verhalten Alkoholiker: Verhalten & Psyche
Neben den körperlichen Symptomen können typische Verhaltensweisen von Alkoholikern wichtige Hinweise liefern. Achten Sie daher auf folgende Anzeichen:
- Gesteigerte Reizbarkeit und Aggressivität
- Verringerte Impulskontrolle und Frustrationstoleranz
- Jovialität und Distanzlosigkeit
- Vernachlässigtes körperliches Erscheinungsbild
- Neigung zur Bagatellisierung
- Probleme in der Beziehung, Familie oder Ehe
- Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und häufige Krankenstände
- Alkoholbedingte Delikte im Straßenverkehr, Führerscheinverlust
- Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit
- Kurzzeitige, wiederholte Krankenstände vor und nach dem Wochenende; oft von einer dritten Person (z. B. Partner) gemeldet
- Häufige Missgeschicke und kleinere Unfälle
- Schwankendes Leistungs- und Durchhaltevermögen
Alkoholsucht früh erkennen: Wann beginnt Alkoholabhängigkeit?
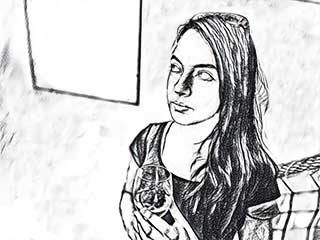
Einer Alkoholsucht geht in den meisten Fällen eine lange Phase des chronischen Alkoholmissbrauchs voraus. Idealerweise sollte bereits beim ersten Verdacht eines Alkoholproblems mit einer Intervention begonnen werden. Ist das Stadium der Alkoholsucht erst einmal erreicht, wird meistens eine langwierige und mühevolle Entzugsbehandlung notwendig. Dann wäre Abstinenz das einzige Behandlungsziel – kontrolliertes Trinken ist nicht mehr möglich. Für viele der Betroffenen ist dies jedoch keine attraktive Zukunftsperspektive. Die Aussicht, nie wieder trinken zu dürfen, treibt sie in erfolglose Versuche, ihren Alkoholkonsum „nur“ zu reduzieren – und damit immer wieder in den Teufelskreis der Sucht.
Dabei wäre zu einem frühen Zeitpunkt eine Rückkehr in ein normales, soziales Trinkverhalten noch möglich gewesen. Die körperlichen und psychischen Folgen des Konsums hätten dann noch rechtzeitig behandelt werden können. Dem Betroffenen wären bleibende Schäden erspart geblieben.
Eine Früherkennung ist also nur im Sinne des Betroffenen. Auch wenn er oder sie das Problem zu bagatellisieren versucht und den Alkoholmissbrauch womöglich abstreitet – es lohnt sich auf jeden Fall, genauer hinzusehen, das Problem anzusprechen und seine Sorgen zu äußern. Zögern Sie auch nicht, eine Beratungsstelle zu kontaktieren, um Ihre Bedenken anonym mit einem Experten zu besprechen.
Alkoholkonsum bei Jugendlichen: Warnsignale und Anzeichen für Alkoholabhängigkeit
Früher oder später machen Kinder Erfahrungen mit Alkohol. Wird der Alkoholkonsum am Wochenende jedoch zur Gewohnheit, machen sich viele Eltern Sorgen um eine mögliche Abhängigkeit. Dabei unterscheidet sich süchtiges Verhalten von Jugendlichen nicht übermäßig von dem Erwachsener. Die Hinweise für Alkoholmissbrauch und die Warnzeichen für eine entstehende Alkoholsucht sind weitgehend dieselben.
Das Ausloten der eigenen Grenzen ist Teil der Entwicklung. Da kann es schon einmal vorkommen, dass Jugendliche über die Stränge schlagen. Man muss dieses Ausprobieren nicht unbedingt gutheißen, es sollte aber auch nicht zu einem Problem aufgebauscht werden. In den meisten Fällen handelt es sich um eine Phase des Experimentierens mit der berauschenden Wirkung – die sich nach einer Weile wieder legt.
Entwickelt sich das Trinkverhalten jedoch in Richtung eines Alkoholmissbrauchs, ist Vorsicht geboten. Achten Sie auf plötzlich auftretende Probleme in der Schule oder Ausbildung. Hat sich der Freundeskreis abrupt geändert? Werden frühere Freizeitaktivitäten und Hobbys vernachlässigt?
Sollten Sie tatsächlich eine besorgniserregende Entwicklung feststellen, gilt es, Ruhe zu bewahren und nicht in Angst zu verfallen. Verzichten Sie auf Vorwürfe und Bestrafungen. Informieren Sie sich und suchen Sie professionelle Hilfe, etwa bei einer Beratungsstelle.
Als verantwortungsvoller Elternteil können Sie einige Punkte beachten, um Ihr Kind zu unterstützen:
- Eigenes Wissen erweitern
Sich über das Thema Alkoholismus und Sucht zu informieren, gibt Sicherheit im Gespräch mit den Kindern. Es hilft, Fragen adäquat beantworten zu können – schließlich sollen sich die Kinder direkt an Sie wenden können. - Sachliche Gespräche führen
Bleiben Sie sachlich und führen Sie klare Argumente an. Bestrafungen helfen nicht und verhindern eine vertrauensvolle Gesprächsbasis. - Interesse zeigen
Zeigen Sie Interesse an den Aktivitäten Ihres Kindes. Alkoholkonsum findet häufig am Wochenende z. B. mit Freunden oder Kollegen statt. Wer sich für das Umfeld, Freunde und Bekannte seines Kindes interessiert, erkennt problematische Entwicklungen früher – auch ohne Nachfragen zu müssen. - Fähigkeiten fördern
Unterstützen Sie Ihr Kind in der Freizeitgestaltung und ermöglichen Sie ihm Hobbys und Aktivitäten. Sie helfen ihm dadurch nicht nur, sein Potenzial zu entfalten, sondern beugen auch Suchterkrankungen vor. - Verantwortung übertragen
Überlassen Sie Ihrem Kind genügend Eigenverantwortung. Es muss seine eigenen Erfahrungen sammeln und einen verantwortungsvollen Umgang mit seiner Umwelt lernen. Akzeptieren Sie die Entscheidungen Ihres Kindes – dies fördert das Vertrauen auf beiden Seiten. - Selbstkritik
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Achten Sie daher auf Ihren eigenen Alkoholkonsum. Was Sie Ihrem Kind vorleben, wird auch sein Verhalten prägen. Klar, niemand ist fehlerfrei. Zeigen Sie daher auch Selbstkritik. Machen Sie es deutlich, wenn Sie sich nicht korrekt verhalten haben. So können Sie Widersprüche vermeiden und glaubwürdig bleiben – etwa wenn Sie Alkoholkonsum kritisieren und dann womöglich einmal selbst zu viel trinken.
Bin ich Alkoholiker? Typische Symptome und Selbsttest
Wenn Sie sich Gedanken über Ihr eigenes Trinkverhalten machen, fällt es leicht, den Konsum einzuschätzen. Schließlich kennen Sie Ihre Trinkgewohnheiten besser als jeder andere – man muss sich selbst gegenüber nur ehrlich sein.
Sie können Ihr persönliches Risiko ganz einfach mit einem Selbsttest feststellen. Hier geht es zum Selbsttest:
Häufige Fragen
Wie erkennt man einen heimlichen Alkoholiker?
Heimliche Alkoholiker versuchen ihren Konsum zu verbergen. Typisch sind Ausreden, Bagatellisierung oder das Herunterspielen des Trinkverhaltens. Oft wird Alkohol versteckt oder heimlich konsumiert. Erste Hinweise sind häufig eine „Alkoholfahne“, Stimmungsschwankungen oder ein gereiztes Verhalten beim Thema Alkohol.
Welche Symptome haben Alkoholiker?
Typische körperliche Symptome sind Zittern, morgendliche Übelkeit, Schwitzen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Gedächtnislücken oder ein aufgedunsenes Gesicht. Mit Fortschreiten der Sucht können Herz-Kreislauf-Probleme, Gewichtsverlust oder Leberhautzeichen hinzukommen. Auch psychische Folgen wie Depressionen oder Angst treten häufig auf.
Welches Verhalten ist bei Alkoholikern typisch?
Betroffene zeigen oft gesteigerte Reizbarkeit, Aggressivität oder Distanzlosigkeit. Sie neigen dazu, ihre Probleme zu bagatellisieren und vernachlässigen ihr äußeres Erscheinungsbild. Schwierigkeiten in Beziehung, Familie oder Beruf sowie häufige Krankenstände oder Missgeschicke sind ebenfalls Warnsignale.
Was sind erste Anzeichen von Alkoholsucht?
Erste Warnzeichen sind Kontrollverlust beim Trinken, steigende Dosis, regelmäßiger Konsum „zur Entspannung“ und erste Entzugserscheinungen wie Zittern oder Unruhe. Auch wenn einzelne Anzeichen normal erscheinen können, deutet das gehäufte Auftreten darauf hin, dass sich eine Abhängigkeit entwickelt.
Wie erkennt man Alkoholismus bei Kindern und Jugendlichen?
Bei Jugendlichen sind Warnsignale plötzliche Probleme in Schule oder Ausbildung, ein veränderter Freundeskreis oder das Vernachlässigen früherer Hobbys. Eltern sollten aufmerksam auf Verhaltensänderungen achten, ohne mit Vorwürfen oder Strafen zu reagieren. Offene Gespräche und professionelle Unterstützung sind hilfreicher.
-
ÖÄZ:
6, 25.März 2012 State of the art – Alkoholabhängigkeit
(Online, letzer Zugriff am )
-
Alkohol ohne Schatten:
Basisinformationen
(Online, letzer Zugriff am )
-
Wenn Alkohol zum Problem wird - Suchtgefahren erkennen - den Weg aus der Abhängigkeit finden
(Online, letzer Zugriff am )
